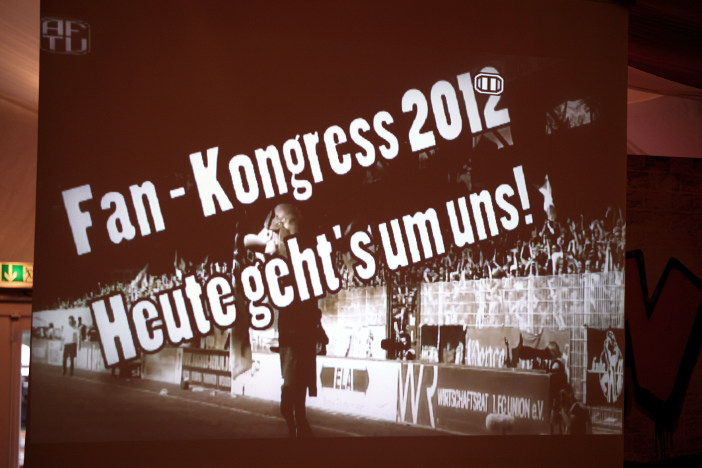Unter besonderer Beobachtung stand am 01.11.2012 der erste bundesweite Fankongress. Auf dem Vereinsgelände des 1. FC Union Berlin hatten sich 250 Fans und Vertreter von 49 Vereinen und erfreulicherweise auch der ein oder andere Verbandsfunktionär eingefunden. Initiiert von den Fans des Gastgebers sollte hier gemeinsam über das weitere Vorgehen im Umgang mit dem Konzeptpapier der DFL diskutiert werden. Von Dynamo-Seite anwesend waren 13 Personen, darunter Fanprojekt, Fanbeauftragter, Fangemeinschaft, wir und UD.
Geprägt von den, vor allem während des Spiels, stimmungsvollen Eindrücken des Vorabends und den ersten Reaktionen des Medienechos waren auch wir gespannt, was der Tag in Berlin bringen würde. Den zahlreichen Medienvertretern unterstellen wir einfach mal echtes Interesse am Thema. Der Empfang unserer Vereins- und Fanvertreter mit den Worten: «Das ZDF hat schon nach euch gefragt.», lässt daran zumindest teilweise zweifeln. Also erstmal inkognito Platz genommen und im Verlaufe des Treffens eher im Hintergrund geblieben.
Durch den Tag zog sich die Forderung, die Fans und ihre Wünsche ernstzunehmen und Ihnen Mitbestimmungsmöglichkeiten einzuräumen. Unaufgeregt wurden von verschiedenen Rednern zu Beginn die aktuellen Zustände zusammengefasst. Besonders die Rolle der Politik wurde intensiv beleuchtet. Anstatt zu versachlichen und bereits umgesetzte positive Maßnahmen hervorzuheben, würde immer reflexartig angeprangert und polemisiert werden. Dabei würden gern einmal falsche Zusammenhänge hergestellt. Dem BVB und auch der SGD beispielsweise wirft man dabei seitens der Hardliner aus Politik und Polizei Machtlosigkeit und Unfähigkeit vor, die Gewalt in den Griff zu bekommen. Doch sogar das umstrittene Sicherheitskonzept «Sicheres Stadionerlebnis» stellt fest, dass der Verein für Vorkommnisse außerhalb des Stadions nicht verantwortlich ist. Dort ist es Aufgabe des Staates für Ordnung zu sorgen, der durch solche Äußerungen anscheinend von den eigenen unzulänglichen Bemühungen ablenken will. Angenehm in diesem Zusammenhang fiel dabei Andreas Rettig auf. Der designierte DFL-Geschäftsführer forderte auf «verbal abzurüsten». Angesichts der bereits am Tag nach dem Pokalauftritt unserer SGD in Hannover sich breitmachenden Hysterie in der Presselandschaft, die zur Veranschaulichung der vermeintlich «bürgerkriegsähnlichen Zustände» gern Bildmaterial falsch verwendete oder mit willkürlichen Unterschriften versah, dringend notwendig.

Hysterische Forderungen nach dem Abbau der Stehplätze, Fußfesseln, Gesichtsscannern und der Übernahme von Polizeikosten werden dabei gleich mit entkräftet. Interessanterweise hat Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern zu Beginn des Jahres eine Machbarkeitsstudie zur Durchsetzung von Gesichtsscannern in Auftrag gegeben. Ein Schelm, der einen Zusammenhang mit der Hardliner-Tour des derzeitigen Vorsitz der Innenministerkonferenz, Lorenz Caffier, vermutet. Die Innenministerkonferenz spricht sich in ihrer endlosen Weisheit übrigens u.a. dafür aus, «zusätzliche Kosten» den Vereinen aufzubürden und dass alle rechtlichen Möglichkeiten gegen Pyrotechniker ausgeschöpft werden. Solche Aussagen dürften ein Graus für jedes Fanprojekt sein, zeigen sie doch, wie massiv eigentlich die Angst der Innenminister vor jugendlichen Pyro-Freunden ist und welche Repression daraus aus Sicht der Innenministerkonferenz folgen müsste. «Erwischte» Pyrotechniker werden übrigens schon lange sanktioniert, liebe Volksvertreter.
Der Sicherheitsbeauftragte Sven Brux vom FC St. Pauli stellte eindrucksvoll heraus, dass eine weitere Kürzung sozialer Ausgaben zu einem immer größeren Umfang sozialer Arbeit der Vereine im Umgang mit den Fans führe. Der Staat würde sich aus der Verantwortung stehlen und im Nachgang die Vereine in die Pflicht nehmen, obwohl sie die Probleme nicht lösen könnten, mit denen sie nur durch Versäumnisse der Politik konfrontiert wären. Er erklärte auch eine Umstrukturierung der Stadien nach englischem Vorbild mit unerschwinglichen Eintrittspreisen für nicht sinnvoll, da Fußball als wichtiges emotionales Ventil der Gesellschaft und vor allem junger Männer wegfallen würde. Gleichwohl nahm er die Medien in die Verantwortung, doch auch mal über die ganzen positiven Effekte der Fanarbeit und die zahlreichen wohltätigen Projekte zu berichten. Hierbei seien auch die oft medienscheuen und misstrauischen Fans gefragt, ihre Position öfter vor einer Kamera sachlich darzustellen um eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen und eigene Interessen zu verbreiten und zu vertreten. Voraussetzung dafür wären aber sauber recherchierte und richtig darstellende Meldungen, die er einforderte.
Allgemein wurde immer wieder der Dialog auf Augenhöhe bekräftigt, bei dem eine sachliche Berichterstattung unumgänglich und notwendig ist. Brux bemerkte, dass auf beiden Seiten immer mehr Quereinsteiger zu finden wären, die den Fußball als Bühne benutzen. Einerseits Funktionäre, denen der Bezug zum Spiel fehle und die marketing- und gewinnorientiert denken würden und zum anderen auch unter den Fans, bei denen mitunter eher die Abenteuerlust und das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe im Vordergrund stehe und einigen der Verein dabei gar nicht so sehr am Herzen liege. Auch die institutionelle Macht einiger Weniger (Verband) gegenüber einer großen dynamischen Masse erfordert dabei Kompromissbereitschaft von allen Seiten. Fans müssten sich dabei auch als verlässlicher Partner zeigen und genau wie alle Beteiligten (Polizei, Verband,…) selbstkritisch das eigene Handeln hinterfragen. St. Pauli-Sicherheitsbeauftragter Brux wusste in diesem Zusammenhang beispielsweise darzulegen, dass sogenannte Vollkontrollen nur sporadisch einsetzbar seien und ohnehin eine hohe rechtliche Hürde überwinden müssen. Daher hält er sie zurecht für nicht sinnvoll um Pyrotechnikschmuggler zu identifizieren.

Einen besonderen Stellenwert nahm die Diskussion um das Konzeptpapier «Sicheres Stadionerlebnis» ein. Missverständnisse wollte hier der DFL-Geschäftsführer und Justiziar Jürgen Paepke ausräumen. Auch er bezog sich auf die sogenannten Vollkontrollen, die von der DFL gar nicht angeordnet werden könnten. Man wolle lediglich Infrastrukturen schaffen, sollten sie notwendig werden. Das ist in etwa so, wie sich ein neues Auto zu kaufen und es nur für den Notfall in der Garage stehen zu lassen.
Befriedigende Antworten blieb er auch zu kritischen Nachfragen bezüglich der vorgeschlagenen Kollektivbestrafung widerspenstiger Fanklubs und dem Personalienaustausch vermeintlicher «Fußballstraftäter» zwischen Polizei und DFL schuldig. Auch widersprüchliche Aussagen zum Umgang mit Pyrotechnik kann Paepke nicht zufriedenstellend erklären. So bleibt nach der anschaulichen Schilderung des repressiven Umgangs mit Auswärtsfans inklusive Durchsuchungen im jugendgefährdenden Bereich durch eine Besucherin aus der Ultràszene nur die logische Forderung, dass Papier in der derzeitigen Form rundweg abzulehnen und in Zusammenarbeit mit den Fans eine neue Lösung zu erarbeiten. Eine Einsicht, die anscheinend auch Andreas Rettig und Jürgen Paepke mittlerweile teilen. Zumindest räumt Paepke ein, dass die vermeintliche Vorgabe der Inhalte und Handlungsanweisungen an die Vereine falsch gewesen seien. Rettig stellt fest, dass nur gemeinsam eine Lösung geschaffen werden kann. Dabei legt er, genauso wie Paepke, großen Wert auf individuelle Lösungen, die den jeweiligen Gegebenheiten der Vereine angepasst sind. Seine Erfahrungen als Bahnfahrer zu Auswärtsfahrten haben Verständnis für die Sorgen der Fans geschaffen, behauptet Rettig.
Besonders gelobt wurde die Arbeit der Fanprojekte, die großartige Sozialarbeit leisten würdem. Rettig unterstreicht eine präventive Arbeit auf hohem Niveau und unisono fordern die Fanvertreter, diese auch durch eine Erhöhung der Finanzierung weiterhin zu erhalten und zu optimieren. Als wichtige Grundlage im Gesamtkonzept des Fußballs dürfen sie auf keinen Fall vernachlässigt werden.

Zu vielen Themen werden an diesem Tag Meinungen und Position bezogen und im Allgemeinen ist man sich einig, oder sieht zumindest Möglichkeiten, Kompromisse zu finden. Nur bei Pyrotechnik bleiben die Fronten verhärtet. Paepke und Rettig sehen keine Grundlage und verurteilen das unkontrollierte Abbrennen. Auch der Sicherheitsbeauftragte Brux steht der Sache skeptisch gegenüber, gibt den Fans allerdings einen Vertrauensvorschuss. Die vorgeschlagenen Möglichkeiten zum kontrollierten Umgang mit Pyrotechnik hätten zumindest eine Chance verdient gehabt. Es war falsch, die Hoffnung spendenden Gespräche abrupt enden zu lassen. Da die Verantwortlichkeit zur Gewährleistungen der Sicherheit im Stadion immer noch beim Verein liegt und dieser somit in Regress genommen wird, sieht er da keine Möglichkeit der Lockerung. Er sehe es zwar auch gern, man müsse sich aber fragen, ob das Gezündel den Verlust vieler Errungenschaften der Fankultur wert sei. Vielleicht, räumt er ein, müsse man die gesamten Rechtsgrundlagen überarbeiten, da sich verändernde gesellschaftliche Phänomene auch eine angepasste Gesetzeslage fordern. Auch Rettig stellt fest, dass die Zeit des Gehorsams vorbei sei.
Abschließend wird in der sachlichen Art und Weise des ganzen Tages ein «live» geschriebenes Positionspapier von allen Anwesenden gemeinsam diskutiert und zurecht gefeilt. Hauptpunkte darin sind, die Positionierung der Fans gegen ein Parallelstrafrecht, das der derzeit gängigen Praxis der auch von Brux für «legitim» gehaltenen Stadionverbote eine Absage erteilen müsste. Kollektivstrafen für widerspenstige Fanclubs werden ebenfalls als nicht haltbar deklariert. Heftig umstritten ist der Paragraph der Gewaltfreiheit, der im Laufe der Feinjustierung besonders genau unter die Lupe genommen wird. Einige Teilnehmer sind der Ansicht, dass eine weitere Rechtfertigung zu diesem Thema nicht mehr notwendig sei. Schließlich wird er etwas abgemildert und tauscht seine Spitzenposition mit einem Platz im Mittelfeld. Es sei wichtig, sich noch einmal dazu zu positionieren. Damit sei dann aber auch genug, ist der Tenor. Weiterhin wird eine stärkere Einbindung der Fans in Entscheidungsprozesse der Vereine gefordert, z.B. durch Mitgliedschaft von Fans in Vereinsgremien. Grundlage dafür ist der regelmäßige und sachliche Dialog zwischen Vereinsvertretern und Fans. Der Fußball kann nur durch die Erkenntnis, dass alle Beteiligten eine Solidargemeinschaft bildeten, in seiner jetzigen Form erhalten werden.

Einen ersten Versuch der Mitbestimmung gibt es bereits im Videotext von Sport 1 zu bestaunen. Hochinvestigativ wird dort die Frage nach einer Einführung von Nacktkontrollen gestellt. Davon abgesehen, dass alle Vertreter am Donnerstag von verbaler Abrüstung sprachen, kann man nur hoffen, dass das nicht exemplarisch für die viel geforderten Augenhöhe, Sachlichkeit und Mitbestimmung ist.
Ein Anfang ist gemacht und wird hoffentlich nicht im Sande verlaufen. Der Wunsch, in dieser Form vereinsübergreifend weiter zu arbeiten, trifft zumindest an diesem Tag auf breite Zustimmung.
Weitere Informationen unter:
Kleine Anfrage der LINKEN zu Ultrà, Finanzierung der Fanprojekte und den Ergebnissen des Runden Tisches des Bundesinnenministeriums vom November 2011
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/080/1708051.pdf
Konzeptpapier «Sicheres Stadionerlebnis»
https://www.dropbox.com/s/b0tekb3hz5o7rqf/Kommission%20Sicherheit_Mitgliederversammlung_27%2009%202012.pdf
Beleg Machbarkeitsstudie Gesichtsscanner
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/087/1708714.pdf (Anfrage)
http://dip.bundestag.de/btd/17/090/1709003.pdf (Antwort)
Danke an Steffen für das zur Verfügung gestellte Bildmaterial!